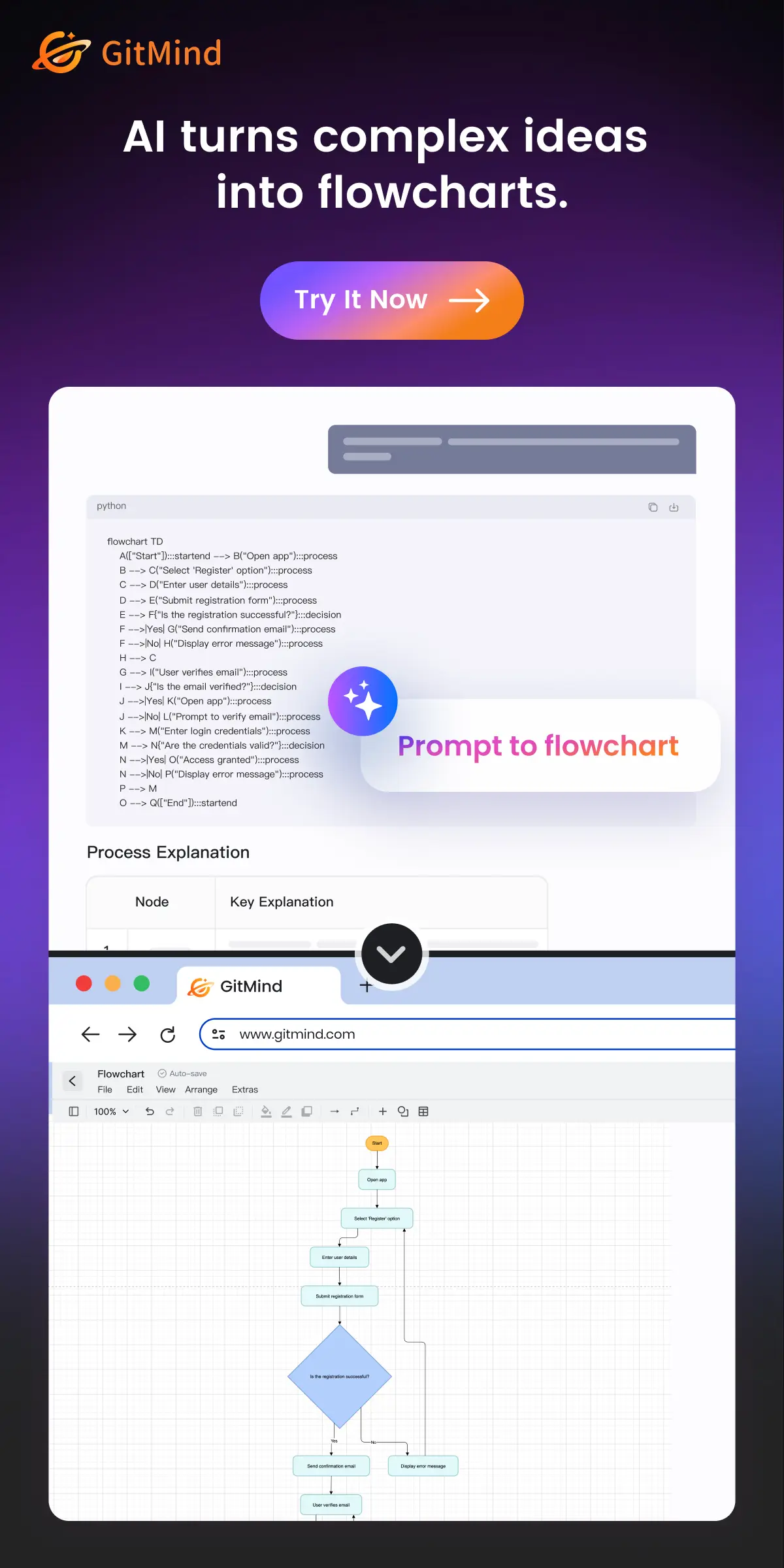Die Krise der psychischen Gesundheit von Studierenden
Angst und Depression am Universitätscampus
Read a summary using the INOMICS AI tool
In den vergangenen Jahren hat sich eine Krise auf Universitätsgeländen der ganzen Welt ausgebreitet - und ich spreche nicht von der COVID-19-Coronavirus-Pandemie. Verglichen mit vorherigen Generationen von Studierenden an Universitäten, haben Studierende heute viel häufiger Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit. Einigen Berichten zufolge leiden 35% der Studierenden im ersten Semester an amerikanischen Universitäten unter Angststörungen - und dieser Prozentsatz gewinnt noch an Bedeutung, da fast 10% der Studierenden in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal an Selbstmord gedacht haben. Seit den 1950er Jahren hat sich die Selbstmordrate an amerikanischen Universitäten verdreifacht. Und Selbstmord ist heute die zweithäufigste Todesursache unter Studierenden. Allein im Vereinigten Königreich begeht alle vier Tage ein Studierender Selbstmord.
Genauso erschreckend ist, dass es anscheinend nicht nur Studierende trifft, sondern alle jungen Menschen. Das belegen die Schlussfolgerungen eines psychiatrischen Berichts aus dem Jahr 2008, in dem festgestellt wurde, dass junge Menschen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit an einer psychiatrischen Störung leiden, unabhängig davon ob sie studieren oder nicht. Studierende neigen dazu, ihre Ängste eher mit Alkoholmissbrauch zu bekämpfen, während Nicht-Studierende eher dazu bereit sind, Drogenmissbrauch zu betreiben. Von den über 43.000 Befragten der ersten Stichprobe, erfüllte fast die Hälfte die Kriterien einer psychiatrische Störung. Es ist blendend offensichtlich, dass es eine Krise der psychischen Gesundheit bei jungen Menschen gibt. Aber warum?
Geld, Drogen und liebevolle Fürsorge
Die Gründe für diese Krise sind vielfältig und komplex. Die oben erwähnte Studie aus dem Jahr 2008 ergab, dass sowohl bei jungen Erwachsenen im Studierendenalter, als auch in der Allgemeinbevölkerung, der Verlust sozialer Unterstützung zu einem gravierenden Anstieg des Risikos für psychiatrische Störungen beiträgt. Eine andere Erklärung, die speziell bei Studierenden zutrifft, ist der Leistungsdruck, dem sie ausgesetzt sind. Von Studierenden wird erwartet, dass sie nicht nur über einen längeren Zeitraum konstant gute Leistungen erbringen, sondern auch gleichzeitig den Umzug an einen neuen Wohnort, eine neue Gemeinschaft mit fremden Menschen und die Verwaltung ihrer eigenen Finanzen managen. Die nicht-studentische Bevölkerung kämpft parallel mit anderen Problemen, wie Arbeitsplatzunsicherheit oder finanziellen Sorgen, möglicherweise auch in Verbindung mit einem Ortswechsel. Für Studierende kommt manchmal noch eine weitere Belastung hinzu: im Vereinigten Königreich oder in den USA sind die Universitätsgebühren so absurd hoch, dass viele Studierende unter finanzieller Anspannung leben und Teilzeitjobs annehmen müssen. Finanzielle Sorgen sind also häufig auch ein Problem von Studierenden.
Aber das sind nicht die einzigen Faktoren. Die genannten Belastungen haben sich im Laufe der Zeit kaum verändert; schon vor einem halben Jahrhundert standen Studierende unter dem gleichen Druck, in einer ungewohnten Umgebung gute Leistungen in ihren Prüfungen zu erbringen. Die finanzielle Belastung war vielleicht geringer, aber auch das kann nicht die enorme Zunahme von psychischen Problemen erklären. Ein großer Unterschied zu damals ist die Akzeptanz psychischer Krankheiten in der Gesellschaft und dadurch die gestiegene Bereitschaft von Studierenden, über ihre Probleme zu sprechen. Dadurch gibt es sicherlich auch mehr Diagnosen als früher, weshalb die Zahl der erfassten Personen mit psychischen Problemen gestiegen ist. Aber auch das ist als Grund nicht ausreichend. Selbst wenn man mögliche Unterschiede in der Erstellung von Statistiken in Betracht zieht, gibt es dennoch einen proportionalen Anstieg bei Studierenden der ganzen Welt, die Hilfe benötigen.
Der vielleicht wichtigste Faktor, der bisher vernachlässigt wurde, ist der Lebensstil. Der durch das Studium verursachte Stress, kann das Schlafverhalten beeinflussen. Es hat sich gezeigt, dass genügend Schlaf eine wesentliche Rolle bei der Bekämpfung von Depressionen spielt. Viele Studierende essen außerdem schlecht, bewegen sich nicht genügend und trinken häufig Alkohol, sei es aufgrund des universitären Lebensstils im Allgemeinen oder als Bewältigungsmechanismus. Einige experimentieren mit Drogen, was am Ende ausschlaggebend werden kann, und eine große Zahl von Studierenden berichtet, dass sie sich isoliert und allein fühlen. Diejenigen, die Schwierigkeiten haben, Freundschaften zu schließen, sind möglicherweise unverhältnismäßig stark betroffen. All die genannten Faktoren, spielen eine große Rolle in Hinblick auf psychische Erkrankungen. Jüngste Studien, u.a. von Dr. Steve Ilardi, haben zum Beispiel gezeigt, dass ein stabiles Umfeld und häufige soziale Kontakte bei der Bekämpfung einer Depression Wunder wirken können. Den ganzen Tag drinnen zu sitzen und auf den Bildschirm zu starren, ist auch deshalb kontraproduktiv, da zu wenig Sonnenlicht ein häufig unterschätzter Faktor ist, der zu psychischen Problemen beiträgt.
Dr. Ilardi empfiehlt zur Bekämpfung psychischer Probleme ein Programm, das regelmäßige Bewegung, ein enges soziales Umfeld, gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf jede Nacht beinhaltet. Seine Studien haben eine Erfolgsrate von 90% (der Erfolg wird daran gemessen, dass die Patienten innerhalb von 12 Monaten nicht rückfällig werden). Sein Programm ist jedoch in Kombination mit den Belastungen und dem Druck des Universitätslebens potenziell schwierig umzusetzen. Aber die Verantwortung liegt hier nicht nur bei den Studierenden. Auch die Universitäten müssen sich Konzepte überlegen, ihre Studierenden besser zu unterstützen.
Probleme des Systems
Die Qualität und vor allem die Verfügbarkeit der psychiatrischen Versorgung variiert von Universität zu Universität - aber im Allgemeinen ist sie unzureichend. Eine Umfrage an der Universität von Kalifornien, San Francisco, ergab, dass von den 24% der Studierenden, die depressiv waren, nur 22% psychiatrische Beratungsdienste in Anspruch nahmen. Drei der Hauptgründe, die von den Studierenden für die Nichtinanspruchnahme der Dienste genannt wurden, waren die Kosten (28%), mangelnde Vertraulichkeit (37%) und ganz oben auf der Liste der Gründe für die Nichtinanspruchnahme: Keine Zeit! (48%) Fast die Hälfte der Studierenden gab dies als Grund an, sich nicht beraten zu lassen. Diese Ergebnisse deuten nicht nur darauf hin, dass die bestehenden Systeme der psychischen Gesundheitsfürsorge für reguläre Studierende nicht bezahlbar sind, sondern vor allem, dass die Universitäten weder einen offenen Dialog bieten, noch Raum für die Studierenden fördern, sich um ihre psychische Gesundheit zu kümmern.
Dieser Raum muss jedoch sofort geschaffen werden. Der Diskurs über psychische Gesundheit verändert sich zwar, aber nicht schnell genug. Eine Studie von 2009 im Journal Medical Care Research and Review, die an amerikanischen Universitäten durchgeführt wurde, fand heraus, dass es für Studierende bei der Entscheidung sich Hilfe zu suchen irrelevant ist, ob sie von Gleichaltrigen dafür verurteilt werden. Ihre persönlichen Gefühle wie Schuld oder Scham spielten bei der Entscheidung eine weitaus wichtigere Rolle und diese sind stark von der eigenen Identität abhängig. Es gibt Gruppen von Menschen, die eher sich selbst die Schuld geben und sich dadurch auch schwerer tun, Hilfe anzunehmen. Zu dieser Gruppe gehören jüngere, asiatische, internationale und/oder religiöse Männer, vorwiegend aus ärmeren Familien. Im Vereinigten Königreich sind Männer genauso häufig depressiv wie Frauen, suchen aber weitaus seltener Hilfe auf. Unterstrichen wird das durch eine andere Statistik: Selbstmord ist die häufigste Todesursache bei Männern unter 45 Jahren, gleichzeitig werden drei Viertel der Selbstmorde im Vereinigten Königreich von Männern begangen. Es ist also absolut notwendig, an Universitäten den Raum zu schaffen, über psychische Probleme zu sprechen.
Chemische Lösungen
Mit diesen Worten ausgedrückt, scheint das Problem unlösbar zu sein; die mentale Gesundheit der jungen Menschen grundlegend in Ordnung zu bringen, erfordert Zeit, Geld und Mitgefühl seitens der Regierung, des Gesundheitssystems und der Universitäten sowie ein Überdenken der Art und Weise, wie wir unser Leben leben wollen. Es gibt aber einige, die nicht auf Lösungen von Seiten der Universitäten warten wollen. In New York hat die Mental Health Association ein Online-Trainingsprogramm ins Leben gerufen, um Pädagogen darin zu schulen, die psychische Gesundheit von Studierenden besser zu unterstützen. Das Programm soll lehren, Anzeichen und Symptome psychischer Gesundheit zu verstehen und deren Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Der Bundesstaat New York hat 2018 ein Gesetz erlassen, das die psychische Gesundheitserziehung in Schulen zur Pflicht macht. In Indien gibt es ähnliche Ansätze. In Mangaluru hat ein Team vor Ort begonnen, Camps zu organisieren, um Lehrer und Eltern für Fragen der psychischen Gesundheit zu sensibilisieren. Es gibt außerdem eine Hotline, das Schülerinnen und Schüler anrufen können, wenn sie Beratung benötigen. Dr. Ratnakar aus dem Team für psychische Gesundheit in Mangaluru, sieht das Hauptziel darin, die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen zu beseitigen. Diese Art von Programmen ist deshalb besonders effektiv, da Probleme direkt in jungen Jahren (in der Schulzeit) angegangen werden und sich dadurch gar nicht erst manifestieren können.
Auf universitärer Ebene müssen Schritte unternommen werden, um psychischen Problemen vorzubeugen und gleichzeitig muss die Möglichkeit geschaffen werden, bei vorhandenen Problemen Hilfe zu erhalten. Die Universitäten sollten einen Lebensstil fördern, der sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit unterstützt, wobei beides zusammenhängt. Konkret sollten zum einen Einrichtungen für kostenlosen Sport zur Verfügung stehen und zum anderen Bibliotheken an einen gesunden Schlafrhythmus angepasste Öffnungszeiten haben. Darüber hinaus sollte ein Umfeld entstehen, in dem ein Gespräch über psychische Gesundheit möglich ist. Universitäten sollten außerdem mit Anbietern von medizinischer Versorgung zusammenarbeiten, um den Studierenden Beratung und Unterstützung durch ausgebildete Fachkräfte zu ermöglichen. Genauso wichtig ist, dass es diese Dienste nicht nur gibt, sondern sie auch unter den Studierenden entsprechend bekannt sind. Häufig wissen Studierende nichts von Beratungs- und Unterstützungsangeboten und nutzen sie daher auch nicht. Besonders wichtig ist die allgemeine Bekanntheit von Notfalldiensten für Menschen, die kurz vor einem psychischen Zusammenbruch stehen oder sich das Leben nehmen wollen - diese Dienste sind unverzichtbar und ihre Existenz muss im Bewusstsein der Studierenden verankert sein.
Es gibt noch eine weitere Sache, die grundlegend geändert werden muss und hier kommen wir auf Dr Ilardis Forschung zurück. Der moderne Lebensstil, charakterisiert durch Schlafmangel, Überarbeitung, Soziale Isolation und Fast Food, begünstigt Depressionen in hohem Maße. Wenn wir also die Zahl der psychischen Erkrankungen verändern wollen, muss dieser sich ändern. Und hier geht es nicht nur um Gesundheitsfürsorge und Gesprächstherapie für Schülerinnen und Schüler; es geht um einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie wir mit der Welt um uns herum umgehen, wie wir unseren Körper behandeln und wie wir unser Leben leben. Solange wir diesen zentralen Strukturwandel nicht vollziehen, werden die Depressionsraten weiter steigen, unabhängig davon, wie viele Psychologen für wöchentliche Beratungen zur Verfügung stehen und wie offen der Diskurs über psychische Erkrankungen wird. Das Problem geht tiefer: Es reicht bis in unseren Körper, bis in die Nahrung, die wir ihm geben, bis zu den Menschen, mit denen wir interagieren, mit anderen Worten, bis in unsere Chemie hinein.
Wenn Du von einer psychischen Krankheit oder psychiatrischen Problemen betroffen bist, was auch immer es sein mag, ist es unerlässlich, mit einem Arzt oder einer psychiatrischen Fachkraft zu sprechen. Wenn Du Selbstmord in Erwägung ziehst, gibt es in den meisten Ländern eine Suizidhilfe-Hotline. In Deutschland lautet die Nummer der Telefonseelsorge 0800-1110111
-
- Other Job
- Posted 1 day ago
Power Systems Engineer
At CV-Library in Stafford, Großbritannien -
- Practitioner / Consultant Job
- Posted 2 weeks ago
SENIOR STRUCTURAL ENGINEER
At Conrad Consulting in Hertford, Großbritannien -
- Practitioner / Consultant Job
- Posted 2 weeks ago
SENIOR STRUCTURAL ENGINEER
At Conrad Consulting in London, Großbritannien